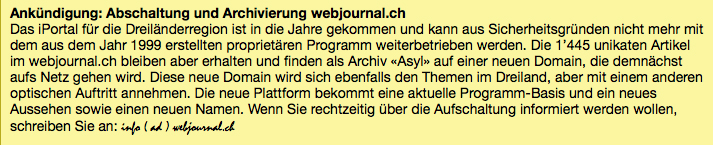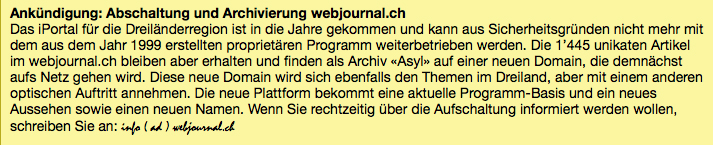|
Aufgegriffen
Aus: Weltwoche Nr. 18/05
Die üblen Marotten der Gäste…
Jede lesenswerte Zeitung hat heute ihre Gastro-Kritik - aber wo bleibt die Kritik am Gast?
Von Redaktion

«La Serveuse» von Edouard Manet: Impression einer klassischen Situation im Lande der Tafelkultur Frankreich.
(red.) Wer schon mal in europäischen Ländern unterwegs war, staunt darüber, wie bescheiden die Tischkultur der Eidgenossen ist, wenn überhaupt vorhanden, wie kulturlos ihr Benehmen und wie anmassend ihre Ansprüche gegenüber dem Servierpersonal hierzulande sind. Nirgends in Europa hat der Serviceberuf ein schlechteres Image als in der Schweiz - vielleicht, weil sich die (meist: ausländische) Bedienung rasch an die hiesigen Gäste angepasst hat?
Was Kellner und Kellnerinnen in der Schweiz mit ihren Gästen erlebt haben, hat der Weltwoche-Journalist Bruno Ziauddin zu einem höchst vergnüglich zu lesenden Artikel zusammengefasst, den das Magazin in einer Sonderausgabe (18/05) zur BuchBasel 2005 veröffentlichte. Damit der Artikel nicht einfach im Altpapier verschwindet, hat das webjournal.ch von Autor und Verlag die ausdrückliche Genehmigung zum Zweitabdruck auf unserem Internet-Portal erhalten. Webjournal.ch hofft unseren Lesern damit ebefalls Vergnügen - oder vielleicht gar: Einsicht - vermitteln zu können.
Der Artikel in Ausgabe 18/05 der Weltwoche erschien im Original unter dem Titel «Das jüngste Gericht». Der nachfolgende Text ist gemäss Vorgabe von Verlag und Autor ungekürzt.
Das jüngste Gericht
-- Von Bruno Ziauddin --
Die Weltwoche bat Kellner zu sagen, was sie denken, wenn sie ihre Kunden anlächeln. Da muss man doch einfach Trinkgeld hinlegen.
«Gäste sind wie Hunde», sagt der Chef de Service. «Zeigt man Angst, beissen sie zu.» – «Wenn du nicht aufpasst», sagt seine Kollegin, «bist du in zwei Sekunden tot.» Die Kellnerin in einem Trendlokal hat festgestellt: «Der Gast will dich destabilisieren. Weil du schön bist, weil du nicht schön bist. Weil du blond bist, weil du schwarzhaarig bist.»
Wird ein Gast in einem Restaurant lausig bedient, beschwert er sich beim Patron. Muss ein Journalist an einer schicken Bar fünf Minuten auf seinen Gin Tonic warten, schreibt er einen bösen Artikel. Aber wem bloss offenbart sich ein Kellner, dem zwei unmögliche Gäste die Schicht zur Überlebensübung gemacht haben?

Édouard Manet: «Chez Père Lathuille» 1879
Entsprechend herzlich wird empfangen, wer Kellnerinnen und Kellnern die Gelegenheit gibt, sich über den Gast und seine Macken zu äussern. Etliche erschienen mit umfangreichen Notizen zum Gespräch; die Belegschaft eines Speiselokals im Zürcher Kreis vier, das vom traditionell kochfaulen Segment der Werber, Grafiker und Medienschaffenden frequentiert wird, schickte einen Fax mit «zehn Todsünden von Gästen», von denen noch die Rede sein wird; andere steuerten telefonische Ergänzungen, Literaturhinweise und Umfragen im Kollegenkreis bei – die Kooperation kannte keine Grenzen.
Was für ein Theater!
Mit Ausnahme eines Schauspielschülers, der temporär kellnert, üben alle Befragten ihre Tätigkeit gerne aus. Mit «90 bis 95 Prozent der Gäste», so das verblüffend homogene Fazit, sei man zufrieden. Jedoch reichen ein oder zwei Schafsköpfe, um einem Kellner die Freude an der Arbeit einen Abend lang zu verderben. Von diesen soll in der Folge hauptsächlich die Rede sein.
Das Personal eines erstklassigen Restaurants in Zürich erhält eines Tages die Warnung, ein besonders schwieriger Gast, «ein alter Nazi», sei im Anmarsch. Dass der rabiate Greis seine Wünsche jeweils quer durch den Saal brüllt (gelernt ist gelernt), kann die kampferprobte Servicebrigade nicht schrecken. Dass er sich «nur von Schweizern oder Deutschen» bedienen lassen will, lässt sich einrichten. Peinlich wird es hingegen, als er eine junge Serviertochter beim Tellereinsetzen (so der Fachausdruck für das Auftischen) auf den Hals küssen will. Peinlich nicht zuletzt für seine Frau, die neben ihm sitzt und die er «Mausezahn» nennt. Der eigens für ihn zubereitete Hauptgang: Taschenkrebs an einer Trüffelsauce, mundet ihm nicht. Er beordert den Küchenchef an den Tisch – und schüttet ihm die Sauce ins Gesicht. Das Happy End: Der Mann hat Hausverbot erhalten.

Edourd Manet: Au Folies Bergère
Im gleichen Etablissement ist einmal eine gutsituierte Männerrunde mit ihren Kindern zu Gast. Ob sich die Begebenheit an einem Muttertag abspielte, ist nicht überliefert. Jedenfalls «kotzt eines der Kinder auf den Tisch», wie sich ein ehemaliger Mitarbeiter erinnert. «Und was machen die Väter? Sie essen seelenruhig weiter, als sei nichts geschehen! Das macht man halt so in dieser Klasse. In einem Bergrestaurant hätte die Serviertochter gesagt: ‹Bitte schön, hier haben Sie einen Lappen.›»
Dem Mitarbeiter liegt jedoch daran festzuhalten: «Ich arbeite sehr gerne in diesem Gästesegment. Das ist Theater pur. Du bedienst Leute, die einen völlig anderen Realitätsbezug haben. Und nicht wenige haben aufgrund ihres geldgeprägten Lebens einen Knall.»
Umgang mit Exzentrikern ist man auch in den führenden Häusern auf dem Platz Genf gewohnt. Ein Kellner berichtet von einem «distinguierten Schweizer Unternehmer» («keine Namen, sorry»), der das Treppenhaus mit dem Pissoir verwechselte. «Niemand hatte genug Eier, ihn zur Räson zu bringen. Darum holten sie mich. Ich habe ihm einfach relativ klar beigebracht, dass wir es gar nicht schätzen, wenn man bei uns an die Wand schifft.»

Edouard Manet: Die Bar in den Folies-Bergère, 1882
Schon fast harmlos mutet dagegen der Fall einer Dame an, die gleichenorts ihr Schosshündchen aus dem Teller fütterte. «Der Maître d’Hôtel nahm den Teller, zerschlug ihn auf dem Boden und sagte: ‹Madame, aus diesem Teller isst kein Mensch mehr.› Die kam nie mehr. Aber mir hat das imponiert.»
Entgegen dem Klischee, dass es bei uns keine «stolzen», «richtigen» Kellner gebe, «so wie in Spanien und Italien», spürt man bei vielen Befragten eine beträchtliche Leidenschaft für ihren Beruf. Ein Chef de Service aus Bern sagt: «Es gibt Abende, da ist es die pure Freude. Du hast das Restaurant voll, verkaufst guten Wein und steigerst dich zu Höchstleistungen – hundert Gäste, alle sind zufrieden, du könntest jeden von ihnen umarmen. Und nach der Schicht, der Adrenalinhahn ist noch offen, setzt du dich mit deiner Brigade an einen Tisch, trinkst ein Glas Wein und stellst fest: Heute haben wir keine Fehler gemacht. So ist Kellnern der schönste Beruf, den es gibt.»

Edouard Manet: Café-concert
Wer mit so viel Hingabe arbeitet, ist gegen Enttäuschungen nicht gefeit: Samuel (die richtigen Namen tun hier nichts zur Sache), seit zwölf Jahren in der Branche, servierte während kurzer Zeit in einem aufgeregten Lokal für Leute mit gesundem Teint und goldener Kreditkarte.
Für ihn sei das ein «extrem schwieriger» Betrieb gewesen. «Diese Art Gäste inszenieren sich andauernd; jeder muss seinen Furz raushängen, fühlt sich wahnsinnig individuell. Und sie sind einfach mühsam zum Bedienen. Da habe ich lieber die sackbürgerlichen Leute. Die haben wenigstens Stil, auch wenn der vielleicht etwas bieder ist.»
«Désolé, wir sind ausverkauft»
Eines Abends bedient Samuel einen Vierertisch, der rege konsumiert und am Schluss eine Rechnung von gegen 700 Franken zu begleichen hat. Irgendwann sieht er ein gebrauchtes Papiertaschentuch am Boden liegen. Offenbar ist jemand erkältet. Ein wenig später liegt ein zweites dort. Am Schluss sind es vielleicht ein Dutzend Taschentücher. «Einer von denen hat sich die Nase geputzt und nachher einfach alles auf den Boden geschmissen. Was mich erschüttert hat: dass niemand vom Personal etwas unternahm, ich natürlich auch nicht, weil ich damals neu war. Das war ein Tiefschlag, von dem ich mich jahrelang nicht mehr erholt habe.»

Pierre-Auguste Renoir: Déjeuner des canotiers
Auch der Chef de Service aus Bern weiss von einem Erlebnis zu erzählen, bei dem ihm «fast die Tränen gekommen sind»: Ein Tisch mit zwölf Personen, Amerikaner, sie bestellen einen 1978er Château Pétrus, 1500 Franken die Flasche. «Sie haben ihn nur bestellt, um ihn über das Tischtuch zu leeren. Weil es so funny aussieht, wie sich der Rotwein auf dem weissen Stoff verteilt. Bei der zweiten Flasche habe ich gesagt: ‹Désolé, wir sind ausverkauft.› Das war zwar absolut nicht wirtschaftlich, aber ich habe gefunden: Nein, bitte nicht nochmals so einen Wein.»

Edgar Degas: Absinth-Trinker
Sabrina, einen Sommer lang tätig im Zürcher Leitlokal für schöne Menschen mit einem Hang zu geweiteten Pupillen, wird diesen Stammgast nie vergessen: «Er bestellt ein Pferdefilet, ‹Was, so klein?, für 43 Franken?, wollen Sie mich verarschen? Ich komme jede Woche, so verjagt ihr die ganz guten Gäste›, und so weiter.» Beim Bezahlen habe er gesagt: «Das war jetzt so schlecht und teuer – von Ihnen würde ich mir nicht einmal mehr einen blasen lassen.»
Ohnehin sind Stammgäste nicht a priori beliebt. Samuel, der Mann mit dem Nastuchtrauma, sagt: «Viele haben das Gefühl, ihnen gehöre der Laden. Man muss ihnen die Wünsche von den Lippen ablesen, alles ist zu teuer und der Wirt sowieso ein Tubel.» Eine junge Kellnerin, die in einer Gault-Millau-Beiz im Mittelland serviert, schaudert es vor einem Habitué mit Alkoholfahne, der meint, im Service seien drei Begrüssungsküsschen inbegriffen. Schwierig auch jener Wirtschaftsanwalt, der alle zwei Wochen zum Lunch kommt und sich jeweils ein bis zwei Flaschen eines Rotweins für 420 Franken leistet.

Manet: La Serveuse de Bocks, 1879
Der Mann könne «so herausfordernd, hektisch und gemein» sein, dass im Service schon manche Träne geflossen sei. «Mich hat er mal gefragt, welche Orangensorte für den Fruchtsalat verwendet werde.» Eigenartig sei: «Sobald das Essen auf dem Tisch steht, ist er ein anderer Mensch.» Und nachher gibt’s Schmerzensgeld: Dreissig Franken sind der Kreditkarte jeweils ungefragt als Trinkgeld zu belasten.
Einen überraschend guten Ruf geniessen Musiker und Fussballer, «auch wenn gewisse Tschütteler das Gefühl haben, sie müssten die ganze Zeit aufstehen und ihre Eier zurechtrücken», wie ein Buffetier beobachten konnte. Eine positive Erwähnung verdienen: Joe Cocker («völlig normal»), Dieter Bohlen («offen und nett»), Sting (während einer Zimmerparty mit astral hübschen Mädchen dem Room-Service gegenüber «respektvoll und relaxed»), Alain Sutter, die Yakin-Brüder sowie Metallica (mit der Entourage bis fünf Uhr morgens für zehntausend Franken Alkoholika konsumiert, jedoch ohne ausfällig zu werden und mit einem «Stimmt so.» auf den nächsten Tausender aufrundend).
Unberechenbare Angelegenheit
Die rund 30000 gastgewerblichen Betriebe im Land – Restaurants, Hotels, Cafés, Bars und dergleichen – beschäftigen 216000 Angestellte. Davon arbeiten etwa 50000 im Service beziehungsweise «an der Front», wie die Tätigkeiten mit Gästekontakt im Branchenjargon heissen – Kellnerinnen und Kellner, Chefs de Service, Barkeeper, ausgebildete Servicefachangestellte.

Die zwei Serviererinnen im nostalgischen Orient-Expresse verlieren bei der harten Arbeit im rumpelnden und schüttelnden Speisewagen die Freude am Beruf nicht - wenn da nur die Gäste nicht meinten, für den teuren Fahrpeis auch noch das Personal schikanieren zu müssen…
Das soziale Prestige, darin sind sich die Interviewten einig, ist nach wie vor tief; entsprechend bescheiden sind die Löhne, die bei monatlich 3120 Franken für Ungelernte beziehungsweise 3525 Franken für Gelernte beginnen, vielfach keinen «Dreizehnten» beinhalten und im Lauf der Jahre nicht wirklich steil nach oben steigen. Allerdings: In der Restauranthauptstadt Zürich kann ein guter Kellner, der im richtigen Lokal arbeitet (ausgebucht, halbjung, teuer), mit 4000 Franken Grundlohn plus 2000 Franken – steuerfreiem – Trinkgeld rechnen.
Was erwartet der Kellner vom Gast?
Laut einer Mitgliederbefragung des Schweizerischen Serviceverbands in erster Linie Freundlichkeit, Respekt und Verständnis für Pannen. Trinkgeld kommt hingegen erst an fünfter Stelle. Vielleicht liegt das auch daran, dass das Trinkgeld im hiesigen Gastgewerbe eine überaus unberechenbare Sache ist. Wann geben die Leute, wer gibt und wie viel? Auch jene, die schon seit zwanzig und mehr Jahren servieren, wissen auf diese Fragen keine verbindlichen Antworten.

Wer keine Tischmanieren, keinen anständigen Umgang hat - dem gehörte vom Kellner mit dem Tranchiermesser ein Ohr ab…
Tendenziell lautet das Fazit so: Auffallend freundliche Gäste geben in der Regel wenig. Geschäftsherren sind in Ordnung, Amerikaner ebenfalls. Männer geben mehr als Frauen. «Wahrscheinlich», räsoniert der Buffetier, «weil das bei den Frauen immer noch drin ist, dass sie sich weniger um die Kohle kümmern müssen. Und oft haben sie halt das Gefühl, dass ihr Charme für vieles entschädigt. Es ist knallhart.» Sabrina bestätigt widerwillig: «Wenn die Kellnerin besser aussieht als der Gast, dann kann sie das Trinkgeld vergessen.» Bei grösseren Gruppen, wo jeder einzeln zahlt, bleibt selten viel liegen, weil alle denken, der andere. Ein Rätsel sind Menschen, die alleine im Restaurant essen. Hier gilt die Faustregel: Je schroffer man sie behandelt, desto spendabler werden sie.
Samuel verliert die Nerven
Auch dies gehört ins Kapitel Trinkgeld: Eine Frau betritt mit zwei wolfsähnlichen Kreaturen ein Lokal in Basel und setzt sich an den grossen, langen Tisch. «Ein nahrhafter Tisch», sagt Marcel, «weil du dort schnell einmal zwanzig Leute bedienst, von denen die meisten möglichst rasch etwas essen wollen, bevor sie ins Kino gehen.» Die Hunde versperren dem im Expressmodus arbeitenden Kellner den Weg; immer wieder muss er mit vollem Tablett über die sabbernden Pelzberge hinübersteigen. Einmal, zweimal, dreimal bittet er die Dame höflich, sie möge doch dafür sorgen, dass die Hunde sich unter den Tisch legen. Erfolglos. Sie lächelt ihm bloss gelangweilt ins Gesicht, wenn ihre Lieblinge nach spätestens zehn Minuten wieder hervorkriechen.
Als es ans Bezahlen der Rechnung geht, lässt die Tierfreundin drei Franken zwanzig Trinkgeld liegen. Marcel sagt sich: «Wart du nur.» Er nimmt die Münzen, rennt ihr nach: «Madame, Sie haben etwas auf dem Tisch liegen lassen!» Sie: «Nein, nein, stimmt schon.» Er: «Für mich hat es den ganzen Abend lang nicht gestimmt. Sie haben mich schikaniert. Nehmen Sie das wieder mit.»
Samuel hat neulich, wie er sagt, «die Nerven verloren» und ist noch einen Schritt weiter gegangen: Bei einem Konflikt um eine Rechnung wurde er von einem Gast in dermassen unerträglich oberlehrerhafter Weise behandelt – wie ein ungezogener Schulgoof –, dass er ihn mit den Worten «Sie brauchen gar nichts zu bezahlen» vor die Tür gestellt hat. Die ausstehenden 120 Franken hat Samuel dann selber übernommen.
Pizza mit feuchtem Gruss
Das Verweigern des Trinkgelds gehört zweifelsohne zu den härteren Massnahmen, die einem Kellner im Konfliktfall zur Verfügung stehen. Dass man ins Bier spuckt, um sich an einem Gast zu rächen, halten die Befragten hingegen für eine Mär. Immerhin ist ein wenngleich länger zurückliegender Fall verbürgt, wo die Küchenhilfe die eine oder andere Pizza jeweils mit einem feuchten Gruss garnierte.
Subtiler geht der Chef de Service aus Bern vor. Einmal hatte er es mit einem etwa zwanzigjährigen Bankierssohn zu tun, der dem Klischee des verzogenen, herablassenden Herrensöhnchens vollauf entsprach. Nach der Vorspeise befand der Chef de Service, das Personal sei nun genug schikaniert. Für den Hauptgang schob er einen Teller in den «Salamander», einen Gratinierofen mit starker Oberhitze. Die beiden ersten Teller zersprangen, der dritte jedoch überlebte unversehrt. Und glühend heiss. Auf diesem servierte er das Filet mignon de veau, den Teller ein wenig zu nahe an der Tischkante platzierend. Der Plan ging auf; beim Versuch, den Teller zurechtzurücken, verbrannte sich der «fils à papa» gehörig die Finger.

Das «Fudidätschle» bei der Serviertochter ist glücklicherweise aus der Mode gekommen, obwohl auch heute noch viele Gäste das weibliche Servierpersonal gerne als «Objekt der Begierde» betrachten und es zumindest mit den Augen begrapschen…
Von «inszenierten Missgeschicken» weiss auch der Buffetier zu berichten. Bei seiner früheren Tätigkeit im Service hatte er einen Stammgast zu bedienen, der einen derart schnippischen und knappen Ton draufhatte, dass irgendwann eine Lektion fällig war. «Stange ha», murmelte der Stammgast wie üblich in seine Zeitung hinein, die vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet war. Der Buffetier legte einen Bierdeckel halb aufs Tischtuch halb auf den Zeitungsrand. Die Schräglage reichte aus, um das Glas zum Kippen zu bringen. «Ich habe mich heftig entschuldigt, x-mal versichert, dass wir die Reinigung der Hose übernehmen, und gleichzeitig in mich hineingelacht. Die Rechnung hat er nie vorbeigebracht. Er aber ist wieder gekommen. Und ich finde, es hat etwas genützt.»
Derlei Notstandsmassnahmen sind natürlich nicht alltagstauglich. Bei kleineren Konflikten, so der Buffetier, fahre man am besten mit dem «Prinzip der verschärften Höflichkeit». Diese Doppelstrategie – Vermeidung eines Eclats einerseits, klares Setzen von Grenzen andererseits – hat er dem «Handbrevier für Hochstapler» des Dadaisten Walter Serner entnommen.

Im Elsass ist das Personal der Gastwirtschaften nicht nur gut ausgebildet, sondern auch hochmotiviert - was ebenfalls auf viele Betriebe in der Schweiz zutrifft. Doch Eidgenossen schätzen das offenbar weniger…
Provozierende oder ungehobelte Gäste, die sofort freundlich werden, wenn der Kellner resolut dagegenhält, sind ein in der Branche häufig beobachtetes Phänomen. Positiv ausgedrückt: Der Gast ist lernfähig. Ein «wuff, wuff» des Kellners, wenn ein Restaurantbesucher mit dem Finger nach ihm schnippt, als sei er ein Hund, hat schon manches Verhältnis entkrampft.
Auch der Chef de Service konnte sich mit einem seiner schwierigsten Gäste arrangieren. Einmal habe er ihm die Küche gezeigt und gesagt: «‹Jetzt müssen Sie sich benehmen, sonst machen wir Gänsebraten aus Ihnen.› Das würde ich sonst nie machen, aber dieser Gast braucht das offenbar. Inzwischen habe ich ihn so weit, dass er mich jeweils fragt: ‹Und? Waren Sie heute zufrieden mit mir?›»
Auch weniger verschrobene Gäste können Servicemitarbeitern an die Substanz gehen. Auszüge aus dem per Fax zugestellten Sündenregister:
• Kaugummi oder Eiswürfel im Aschenbecher;
• Am Stuhl baumelnde Taschen (vor allem Freitag-Taschen) respektive Goretexjackenträger, die ihre Rucksäcke neben sich auf den Boden stellen;
• Männer, die für die Frau bestellen;
• Gäste, die sich ausgerechnet an den einzigen noch nicht abgeräumten Tisch setzen;
• Taube und blinde Zwölfergruppen: «Salat! Wer bekommt den Salat? Hallo, der Salat ist da. Hallo, sorry, Sala-at.»
• Buchhalterisch interessierte Zwölfergruppen: Jeder will seine Vorspeise und sein Mineralwasser und seinen 2/9.-Anteil am Wein individuell ausgerechnet haben und bezahlen, meistens freitagabends um neun, wenn die Beiz voll ist; Zeitverlust für den Kellner: zwanzig Minuten;
• Hahnenwasser, das nicht in Frage-, sondern in Befehlsform bestellt wird;
• Nach elf Uhr morgens Cappuccino oder Latte macchiato bestellen; vermutlich ein aus Deutschland importierter Savoir-vivre-Unsinn; ist stillos und mühsam zu machen (Gruss vom Buffet!);
• Sofort zahlen wollen und dann noch zwanzig Minuten sitzen bleiben.
In den Vereinigten Staaten behelfen sich Servicemitarbeiter mit eigenen Websites und Diskussionsforen, um aufwühlende Begegnungen mit Restaurantbesuchern zu verarbeiten. Auf www.stainedapron.com wird jeweils ein Restaurantbesucher zum «Depp des Monats» gekürt. In der Rubrik «Lasst Euren Balg zu Hause» berichten Kellnerinnen und Kellner von einschlägigen Erfahrungen mit Kindern. Unter «Rache ist süss» werden Strategien der kontrollierten Eskalation ausgetauscht, wenn das Stilmittel der gehobenen Augenbraue nicht mehr verfängt (Abführmittel unters Essen mischen, zum Beispiel).
Aber nicht nur Abrechnungen mit Gästen, auch Konstruktives findet seinen Weg auf die Websites. Zum Beispiel der Vorschlag, jeder Restaurantbesucher müsse einen zweiwöchigen Kurs ablegen, bevor er ein Lokal betreten darf. Wer besteht, erhält einen Fähigkeitsausweis, den es alle paar Jahre zu erneuern gilt.

Carolane will dereinst einmal Serviererin oder Tierärztin werden. Mit diesen Berufswünschen lässt das Mädchen sie erkennen, dass sie eine Französin ist. In der Schweiz steht der Service-Beruf am untersten Ende der Berufswünsche Jugendlicher. Wohl wegen der Gäste…
Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Seite www.bitterwaitress.com, die sich mit einer für amerikanische Kellner kardinalen Frage auseinander setzt: dem Trinkgeld. Ihr Filetstück ist die Shitty Tipper Database (kurz: STD), eine Art elektronischer Pranger für knauserige Trinkgeldgeber. Der Datenbank entnehmen wir, dass neulich ein Lorenzo Flowers mit seiner Begleitung im Restaurant «Roosters Barnyard» für US-$ 368.42 (450 Franken) diniert hat, ohne einen Cent Trinkgeld zu hinterlassen.
Weil in den USA die sogenannten Tips bis zu achtzig Prozent des Lohns ausmachen, verlieren Serviceangestellte in solchen Fällen relativ schnell die Contenance. So kommt es, dass es die Shitty Tipper Database punkto Dichte an Verbalinjurien mit jedem Fluchwörter-Dictionnaire aufnehmen kann. Im Fall von Mister Flowers tönt das dann so: «Arsch mit Brille, ekliger Perversling; feiert gerne Partys, aber gibt nie Trinkgeld. Cheap Fuck!»
Der feine Mister Moore
Einen speziellen Reiz der STD machen die Namen von Prominenten aus. Schauspieler Sean Penn etwa (Tatort: New Orleans; Konsumation: 450 Dollar; Trinkgeld: 0) oder die Tennisschwestern Serena und Venus Williams (Boston; 180 Dollar; Trinkgeld: 20 Dollar, was knapp der Hälfte der in den USA erwarteten fünfzehn bis zwanzig Prozent entspricht). Star der Liste ist ... Michael Moore, Darling aller politisch engagierten Coiffeusen und Inlineskater, der es gleich zu zwei Einträgen gebracht hat.
Der Kellner eines New Yorker Restaurants, der sich für Moore «einen Abend lang den Arsch aufgerissen hat» und dafür mit einem Dollar und 27 Cent belohnt wurde, formuliert seine Gefühle für den sozial engagierten Dokumentarfilmer so: «Zuerst maulte der fette Bastard herum, weil kein Fensterplatz mehr frei war. Dann bestellte er solche Mengen, dass ich mich eine Woche lang davon hätte ernähren können. Und wie er das Personal behandelte, lässt nur einen Schluss zu: MM ist ein aufgeblasener Arsch.»
-- Von Bruno Ziauddin --
Literatur zum Thema:
• Anthony Bourdain: Geständnisse eines Küchenchefs. Was Sie über Restaurants nie wissen wollten. Goldmann, 2003. Fr. 16.50
• Debra Ginsberg: Waiting. The True Confessions of a Waitress. Perennial, 2001. 320 S., $ 9.75
(über www.amazon.com)
• Studs Terkel: Working. New Press, 1997. 640 S. $ 10.40 (über www.amazon.com)
Von Redaktion
Für weitere Informationen klicken Sie hier:
• «Stained Apron» - Gäste-Kritik aus USA
• Bitterwaitress: Geiz-Horror in den USA
|